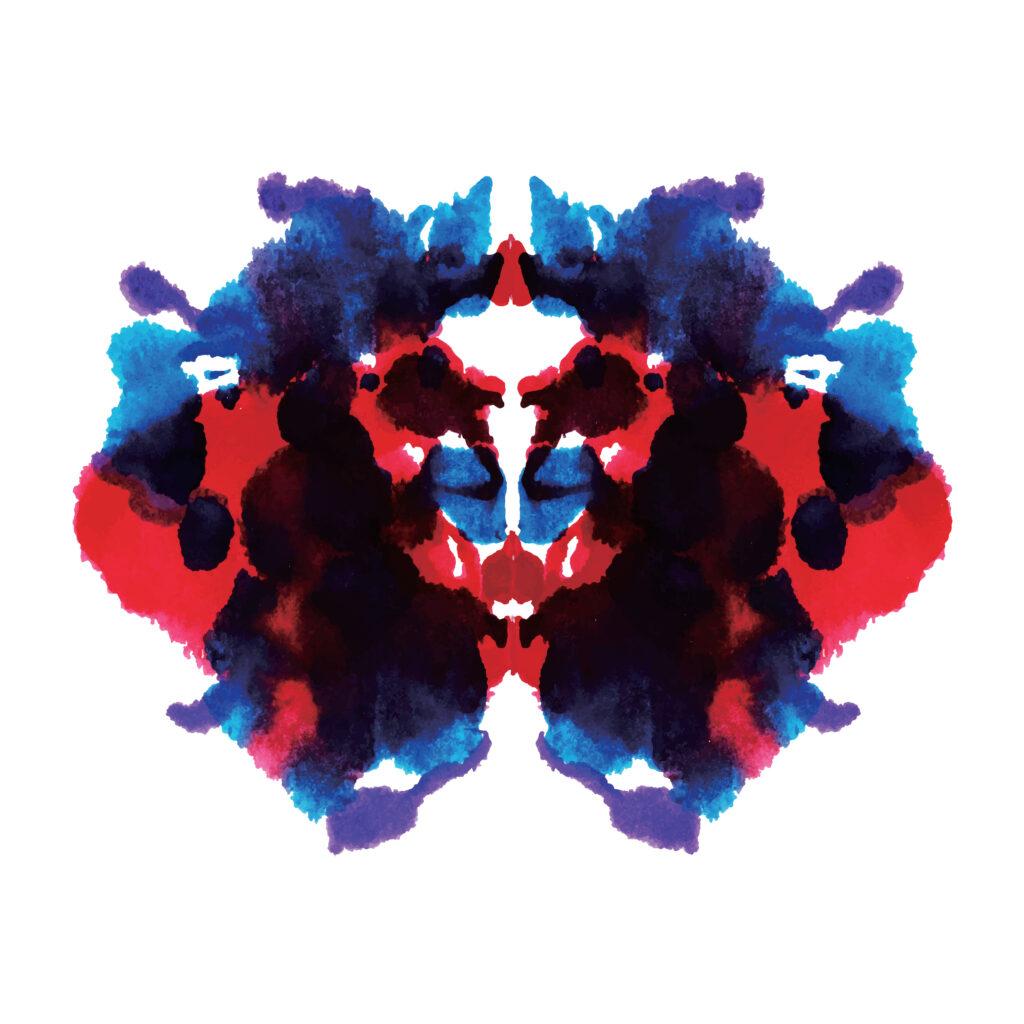Witwen und Witwer von verstorbenen Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit sowie Ruhestandsbeamtinnen und -beamten können einen Anspruch auf Witwengeld haben.
Das Witwengeld ist bares Geld wert.
Schlimm wird es, wenn dem Antrag aufgrund der Ausnahmeregelung zur Versorgungsehe nicht stattgegeben wird.
Wir haben daher mit Freude das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 12.05.2025, Az. 2 LB 557/22, gelesen.
Das Urteil würdigt die Beziehung zweier Menschen juristisch streng, zugleich aber auch liebevoll und einfühlsam.
Anlass genug, mit einem Blog-Artikel die wichtigsten Fragen rund um das Witwengeld anhand des Urteils aufzugreifen.
I. Was ist die Rechtsgrundlage für Witwengeld?
Rechtsgrundlage für das Witwengeld ist § 19 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG.
Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit, der die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 BeamtVG erfüllt hat, oder eines Ruhestandsbeamten erhält danach Witwengeld.
Die Beamtenversorgungsgesetzte der Länder enthalten identische oder ähnliche Regelungen. Für hamburgische Beamte gilt zum Beispiel § 23 HmbBeamtVG.
II. Wann erhalten Witwen und Witwer kein Witwengeld?
Das Witwengeld ist ausgeschlossen, wenn eine der beiden Ausnahmen von § 19 Abs. 1 Satz 2 BeamtVG erfüllt sind.
Nach § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BeamtVG wird Witwengeld in der Regel nicht gewährt, wenn die Ehe mit dem Verstorbenen nicht mindestens ein Jahr gedauert hat.
Davon wird jedoch wieder eine Ausnahme geregelt:
Ist nach den besonderen Umständen des Falles die Annahme nicht gerechtfertigt, dass es der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat war, der Witwe eine Versorgung zu verschaffen, ist Witwengelt doch zu gewähren.
Dieser Ausnahmefall wird auch als Versorgungsehe bezeichnet.
Um diesen Ausnahmefall ging es in dem hier besprochenen Urteil.
Ein Witwengeld wird nach § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BeamtVG nicht gewährt, wenn die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den Ruhestand geschlossen worden ist und der Ruhestandsbeamte zur Zeit der Eheschließung die Regelaltersgrenze nach § 51 Abs. 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes bereits erreicht hatte.
Mit dieser Ausnahmeregel beschäftigen wir uns in diesem Beitrag nicht weiter vertiefend.
Beide Ausnahmen sind in den Versorgungsgesetzen der Länder ähnlich oder identisch geregelt.
III. Wann liegt eine Versorgungsehe vor?
Eine Versorgungsehe liegt vor, wenn eine oder beide Partner hauptsächlich wegen der zu erwartenden Hinterbliebenenversorgung geheiratet haben.
Das Gesetz vermutet eine solche Versorgungsehe nach § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BeamtVG, wenn die Ehe zwischen der Eheschließung und dem Tod nicht mindestens ein Jahr gedauert hat.
IV. Wann liegt keine Versorgungsehe vor?
Eine Versorgungsehe liegt nicht vor, wenn besondere Umstände des Falles nicht die Annahme rechtfertigen, dass der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat war, der Witwe oder dem Witwer einen Versorgungsanspruch zu verschaffen.
Wann entgegenstehende besondere Umstände des Falles vorliegen, ist in jedem Fall konkret zu prüfen.
Das OVG Mecklenburg-Vorpommern zitiert in seinem Urteil zu den besonderen Umständen, die der gesetzlichen Vermutung entgegenstehen das Bundesverwaltungsgericht (vgl. BVerwG Urt. v. 28.01.2016 – 2 C 21.14 –, Rn. 16)
„Umstände, bei denen ein anderer Beweggrund als der der Versorgungsabsicht nahe liegt, sind etwa dann gegeben, wenn der Beamte unvorhergesehen stirbt, im Zeitpunkt der Heirat also nicht mit seinem Tod zu rechnen war. Beispiele hierfür sind etwa der Unfalltod, eine erst nach der Heirat aufgetretene oder bekannt gewordene tödliche Erkrankung und ein Verbrechen (vgl. BSG, Urteil vom 5. Mai 2009 – B 13 R 55/08 R – BSGE 103, 99 Rn. 26).
Muss hingegen im Zeitpunkt der Heirat mit dem Tod des Beamten gerechnet werden – etwa bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung -, liegt die gesetzliche Vermutung einer Versorgungsehe nahe, sie kann indes widerlegt werden. Auch ein bereits vor der Kenntnis von der lebensbedrohlichen Erkrankung getroffener Heiratsentschluss kann ein besonderer Umstand im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BeamtVG sein, sofern die Heirat aus wirklichkeitsnahen Gründen nur aufgeschoben wurde, der Heiratsentschluss aber nicht aufgegeben worden ist (Fortentwicklung der früheren Begrifflichkeit des Senats zur „konsequenten“ Verwirklichung des vor der Kenntnis der lebensbedrohlichen Erkrankung gefassten Heiratsentschlusses: BVerwG, Beschlüsse vom 2. Oktober 2008 – 2 B 7.08 – juris Rn. 3, vom 19. Januar 2009 – 2 B 14.08 – juris Rn. 7 und vom 3. Dezember 2012 – 2 B 32.12 – juris Rn. 10).
Die gesetzliche Vermutung des § 19 Abs. 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BeamtVG ist widerlegt, wenn die Gesamtbetrachtung der Beweggründe beider Ehegatten für die Heirat ergibt, dass die von der Versorgungsabsicht verschiedenen Beweggründe insgesamt gesehen den Versorgungszweck überwiegen oder ihm zumindest gleichwertig sind. Es ist daher auch nicht zwingend, dass bei beiden Ehegatten andere Beweggründe als Versorgungsgesichtspunkte für die Eheschließung ausschlaggebend waren. Vielmehr genügt es, wenn für einen der Ehegatten der Versorgungsgedanke bei der Eheschließung keine Rolle gespielt hat (vgl. BSG, Urteil vom 5. Mai 2009 – B 13 R 55/08 R – BSGE 103, 99 Rn. 21).
Allerdings müssen bei dieser Gesamtbewertung die gegen eine Versorgungsehe sprechenden besonderen Umstände umso gewichtiger sein, je offenkundiger und je lebensbedrohlicher die Krankheit des Beamten zum Zeitpunkt der Heirat war (vgl. BSG, Urteil vom 5. Mai 2009 – B 13 R 55/08 R – BSGE 103, 99 Rn. 27). Ebenso steigen mit der Dauer des zeitlichen Abstands zwischen dem Heiratsentschluss und der später in Kenntnis der lebensbedrohlichen Erkrankung erfolgten Heirat die Anforderungen an die Wirklichkeitsnähe der Gründe für den Aufschub der Heirat.“
Damit bestätigt das Gericht die Rechtsprechung des höheren Gerichts und gibt dem Leser seinen Prüfungsmaßstab mit auf den Weg.
V. Wer muss die besonderen Umstände, die eine Versorgungsehe widerlegen, beweisen?
Die besonderen Umstände, die eine Versorgungsehe widerlegen, müssen durch die Witwe oder den Witwer bewiesen werden (vgl. hierzu OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 30. Januar 2012 – 3 E 1364/11 –, Rn. 4).
VI. Wie Beweise ich die besonderen Umstände, die eine Versorgungsehe widerlegen?
Es kann in der Praxis sehr schwierig werden, den notwendigen Beweis zu führen.
Der Fokus sollte nicht allein auf beide Partner zusammen, sondern auch auf jeden Partner einzeln gelegt werden.
Dazu sollten Beweise gesammelt und aktiv in das Verfahren eingebracht werden.
In der hier besprochenen Entscheidung ist erkennbar, dass die Witwe alle Register der Beweisführung gezogen hat.
Es wurde der konkrete Beziehungsverlauf geschildert, Stellungnahmen von Freunden und Verwandten eingeholt und am Ende auch Freunde und Verwandte als Zeugen im gerichtlichen Verfahren vernommen.
Bei einer Erkrankung können darüber hinaus medizinische Unterlagen über die Krankheit, wie z.B. Atteste, Berichte und Gutachten eine Rolle spielen.
Es kann auch sinnvoll sein, wenn Betroffene ihre finanziellen Verhältnisse offen legen.
Das kann zwar unangenehm für ältere Menschen sein, die gelernt haben, nicht über Geld zu sprechen.
Aus dem Umgang mit den Finanzen in der Beziehung lässt sich aber mitunter ableiten, dass die Ehe nicht überwiegend geschlossen wurde, um einen Versorgungsanspruch zu begründen.
Für eine echte Lebensgemeinschaft sprechen auch ein gemeinsamer Haushalt, gegenseitige Pflege und Fürsorge, gemeinsame Zukunftspläne sowie der Verzicht auf günstigere Versorgungsmöglichkeiten.
Gegen eine reine Versorgungsehe spricht es eher, wenn eine eigene finanzielle Absicherung der Witwe vorhanden ist, keine Kenntnis über die Versorgungsansprüche nach dem BeamtVG vorlagen und emotionale Gründe für die Heirat angeführt werden können.
VII. In welchen Fällen kann die Versorgungsehe ein Problem werden?
Wann die Versorgungsehe zum Problem wird, lässt sich nicht abschließend beschreiben.
Besonders relevant wird die Versorgungsehe bei
- bei einer Eheschließung im fortgeschrittenem Alter,
- bei einer Heirat wenige Monate vor dem Tod des Verstorbenen (weniger als ein Jahr),
- bei einer Heirat, bei der die schwere Erkrankung des später Verstorbenen bereits bekannt ist,
- bei einer Heirat, bei der der Verstorbene finanziell deutlich besser gestellt war.
VIII. Mein Antrag auf Witwengeld wurde abgelehnt. Was kann ich tun?
Wurde ein Antrag auf Witwengeld abgelehnt, kann gegen den Ablehnungsbescheid Widerspruch oder Klage erhoben werden.
Ob ein Widerspruch oder ein Klage zu erheben sind, ergibt sich aus dem jeweils anzuwenden Recht.
Die Ablehnungsbescheide enthalten in der Regel eine Rechtsmittelbelehrung, die darüber aufklärt
In einem Widerspruchsverfahren kann der Dienstherr seine Ausgangsentscheidung überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Das gleiche können Gerichte im Klageverfahren tun.
IX. Brauche ich einen Anwalt in einem Verfahren zum Witwengeld?
In einem Antragsverfahren, Widerspruchsverfahren sowie einem Klagverfahren in erster Instanz besteht kein Anwaltszwang.
Dennoch empfehlen wir eine anwaltliche Vertretung dringend.
Betroffene sind häufig emotional stark eingebunden.
Sie übersehen häufig sachdienliche Hinweise, die sie dem Dienstherrn geben können.
Als Anwalt für Beamte berate und vertrete ich Beamtinnen und Beamte in Angelegenheiten zum Witwengeld.
Ob und wie eine anwaltliche Tätigkeit sinnvoll ist, können wir in einem Erstberatungsgespräch besprechen.